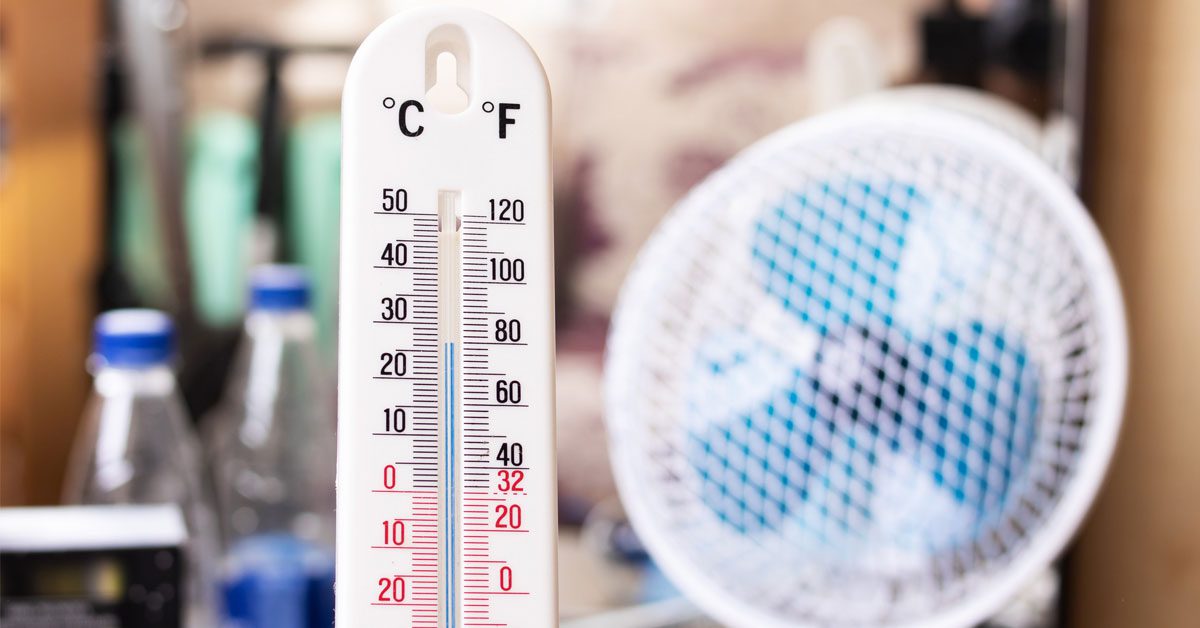Wer schon mal im Hochsommer in einer aufgeheizten Halle geschuftet hat oder im Winter in einem zugigen Büro fror, weiß: Die Temperatur am Arbeitsplatz ist kein Luxusproblem. Sie wirkt sich direkt auf unsere Leistungsfähigkeit, Gesundheit und sogar unsere Sicherheit aus. Wir alle in Westeuropa haben dies während der letzten Hitzewelle noch vor kurzem am eigenen Leib erfahren. Dennoch wird das Thema in vielen Unternehmen noch immer stiefmütterlich behandelt – obwohl es klare rechtliche Vorgaben und zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse zur idealen Arbeitsumgebung gibt. Grund genug für Shoes For Crews uns etwas genauer mit dem Thema zu beschäftigen. Im Folgenden erfahren Sie daher alles Wissenswerte zum Thema und wie Sie Ihre Angestellten bestmöglich schützen können.
Zwischen Hitzestress und Kältestarre
Die Umgebungstemperatur hat einen enormen Einfluss auf unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Hohe Temperaturen lassen uns langsamer denken – das belegt nicht zuletzt auch eine Studie der Harvard Chan School. Bereits kleine Abweichungen von der individuellen Komforttemperatur können spürbare Folgen haben: Zu hohe Temperaturen führen zu Konzentrationsstörungen, erhöhter Fehlerquote und schnellerer Erschöpfung. Wer schwitzt, verliert Flüssigkeit und Elektrolyte – das macht müde, reizbar und im schlimmsten Fall sogar benommen.
Andererseits macht Kälte uns träge, verspannt die Muskulatur und erhöht das Risiko für Erkältungen und chronische Beschwerden wie Gelenkprobleme. Gerade in Branchen mit hohem körperlichem Einsatz – etwa in der Logistik, im Rettungsdienst oder der Getränke- und Lebensmittelproduktion – kann das zu echten Gefahren führen. Auch in Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und im Einzelhandel sind Mitarbeitende durch falsch temperierte Räume zusätzlichen Belastungen ausgesetzt.
Was sagen die Vorschriften?
In Deutschland regelt die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) gemeinsam mit der technischen Regel ASR A3.5 (vgl. Punkt 4 Raumtemperatur), welche Temperaturen am Arbeitsplatz zulässig und zumutbar sind. Dort heißt es:
- Leichte Tätigkeiten (z. B. Büroarbeit): mindestens 20 °C
- Mittelschwere Tätigkeiten (z. B. Verkauf, Pflege): mindestens 19 °C
- Schwere körperliche Arbeit (z. B. Lager, Produktion): mindestens 12 °C
Im Sommer liegt der kritische Bereich bei etwa 26 °C. Überschreitet die Raumtemperatur diese Schwelle, muss der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, etwa durch Lüftung, Abschirmung gegen Sonneneinstrahlung oder flexible Arbeitszeiten.
Diese Vorgaben sind nicht nur Richtwerte – sie sind Teil der gesetzlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Wer sie ignoriert, riskiert nicht nur Beschwerden, sondern auch juristische Konsequenzen.
Ein Beispiel aus der Praxis
Nehmen wir den Fall einer Großküche in einer Seniorenresidenz. Hier treffen gleich mehrere Herausforderungen aufeinander: hohe Luftfeuchtigkeit, heiße Kochflächen, Zeitdruck und körperliche Belastung. Ohne effektive Belüftung und ausreichend klimatisierte Bereiche steigt die Innentemperatur schnell auf über 30 °C. Die Mitarbeitenden schwitzen, trinken zu wenig, und die Fehlerhäufigkeit bei der Speisenzubereitung nimmt zu. Gleichzeitig erhöht sich die Unfallgefahr – rutschige Böden, unkonzentriertes Arbeiten und Kreislaufprobleme sind keine Seltenheit.
In einer anderen Situation – etwa einem Postzentrum im Winter – ist das Gegenteil der Fall: Offene Tore, lange Wege und schlecht isolierte Hallen sorgen für bibbernde Finger und Muskelverspannungen. Wer bei solchen Bedingungen Pakete wuchtet oder Scanner bedient, riskiert dauerhafte körperliche Beschwerden – und langfristig auch Ausfälle im Team.
Temperatur als Führungsthema
Ein angenehmes Raumklima am Arbeitsplatz ist mehr als nur ein Hygienefaktor – es ist Ausdruck von Wertschätzung und Professionalität. Mitarbeitende, die sich wohlfühlen, arbeiten nicht nur effektiver, sondern auch sicherer. Sie machen weniger Fehler, sind seltener krank und bleiben dem Unternehmen länger treu.
Führungskräfte und Verantwortliche sollten das Thema daher nicht an Hausmeister oder Facility Management delegieren, sondern aktiv mitgestalten. Regelmäßige Raumklimamessungen, Feedbackrunden, flexible Kleidungsvorgaben oder Pausenregelungen können helfen, die individuelle Belastung zu reduzieren – ohne große Kosten, aber mit großem Effekt.